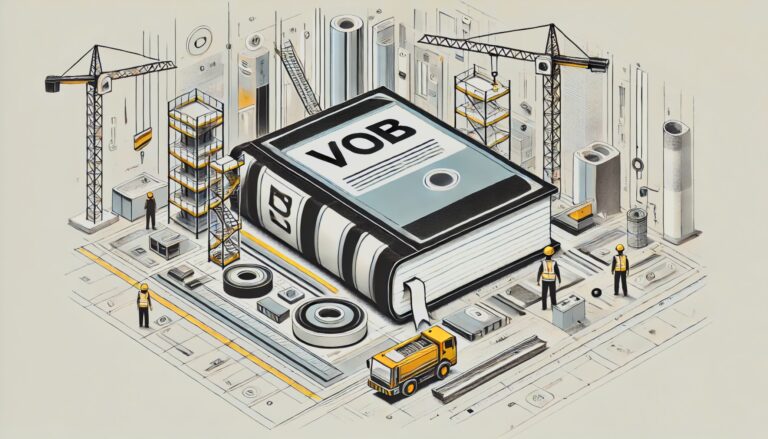
»Erfahrung im Umgang mit der VOB ist essenziell, um als Auftragnehmer überhaupt in Betracht gezogen zu werden«
Ohne fundierte VOB-Kenntnisse sind praktisch keine großen Aufträge mehr zu gewinnen. Dennoch haben vor allem kleinere Handwerksbetriebe noch Defizite. Im Interview erklärt Dr. Ing. Magdalena Jost, woran es meist hapert und wo fehlendes Wissen den Betrieben viel Geld kosten kann.
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist für TGA-Unternehmen in den letzten Jahren von immer zentralerer Bedeutung geworden. Ohne fundierte Kenntnisse sind öffentliche und auch ein Großteil privater Aufträge nicht zu gewinnen. Deshalb bietet die Builtech-Gruppe über die hauseigene Builtech Academy seit vergangenem Jahr intensive Schulungen für seine Unternehmen an. Dr. Ing. Magdalena Jost, Fachdozentin der Bauakademie Berlin, ist ausgewiesene Expertin im Bereich VOB und leitet Seminare dieser Art bereits seit Jahren.
Frau Dr. Jost, Sie geben viele Seminare im Bereich VOB und haben bereits mit zahlreichen Betrieben gearbeitet. Wie fit sind die deutschen Handwerksunternehmen ihrer Meinung nach in der VOB?
Das Niveau ist sehr unterschiedlich. Bei größeren Unternehmen sind die Kenntnisse im Bereich VOB und Vertragsrecht in der Regel gut ausgeprägt. Bei kleineren Handwerksbetrieben gibt es dagegen häufig noch Defizite. Erfreulicherweise beobachte ich in letzter Zeit aber auch hier eine positive Entwicklung. Immer öfter bereiten Betriebe zum Beispiel wichtige Unterlagen wie Behinderungsmitteilungen oder Bedenkenanzeigen bereits vor und haben diese im Intranet griffbereit. Die Tendenz geht also klar in Richtung einer intensiveren Auseinandersetzung mit der VOB. Man sollte sich aber nicht auf nur einmalig erworbenes Wissen verlassen – man muss am Ball bleiben und sein Wissen kontinuierlich vertiefen.
Wie erklären Sie sich das Aufholen der kleineren Betriebe?
Die Zeichen der Zeit werden immer deutlicher erkannt. In einem zunehmend schwierigen Auftragsmarkt suchen die Betriebe vermehrt den Anschluss an große und öffentliche Auftraggeber. Das gilt insbesondere für den TGA-Bereich. Wenn man sich vertraglich an solche Auftraggeber binden möchte, ist die VOB nahezu unerlässlich: Bei öffentlichen Projekten ist sie zwingend, bei größeren privaten Projekten bildet sie in 80 bis 90 Prozent der Fälle die Grundlage. Fachkunde, Zuverlässigkeit und Erfahrung im Zusammenhang mit der angebotenen Leistung wie auch im Umgang mit der VOB sind essenziell, um überhaupt als potenzieller Auftragnehmer in Betracht gezogen zu werden.
 Dr. Ing. Magdalena Jost bei einem Seminar für die Builtech Academy.
Dr. Ing. Magdalena Jost bei einem Seminar für die Builtech Academy.
Trotzdem klaffen hier und da immer noch Wissenslücken. In welchen Bereichen der VOB besteht Ihrer Erfahrung nach der größte Nachholbedarf in Handwerksbetrieben?
Es herrscht immer großes Erstaunen, wenn ich in Seminaren die Frage stelle, welche Befugnisse denn eigentlich der Architekt oder Bauleiter des Auftraggebers auf der Baustelle hat. Die intuitive Antwort der meisten Teilnehmer lautet: “Er ist der Vertreter des Auftraggebers. Der hat den Hut auf”. Er hat zweifelsohne den Bauablauf im Sinne des Auftraggebers zu koordinieren, also fachlich-technische Befugnisse, aber nicht bei Rechtsgeschäften, zumindest nicht ohne besondere Vollmacht! Wenn es z. B. um Leistungsänderungen geht oder um zusätzliche Leistungen oder auch um die Beauftragung von Stundenlohnarbeiten – und seien sie auch noch so klein – liegen die Befugnisse an anderer Stelle, nämlich ausschließlich beim Auftraggeber. Ein weiteres Beispiel ist das Thema Abnahme: Die VOB regelt diese durchaus vorteilhaft für den Auftragnehmer. Man kann beispielsweise eine Abnahme erwirken, auch wenn der Auftraggeber diese ungerechtfertigt verweigert. Man muss nur wissen, wie. Auch im Bereich der Mängelrechte und Nachträge ist das Wissen häufig unzureichend. Das Gleiche beobachte ich beim Thema Subunternehmen.
Auch kleinere TGA-Betriebe arbeiten vermehrt mit Subunternehmen zusammen…
Genau! Und plötzlich finden sie sich in einer Zwitterstellung wieder – als Auftragnehmer und zugleich als Auftraggeber. Das führt oft zu Unsicherheiten, etwa bei der Handhabung von Mängeln, die ein Subunternehmen verursacht hat, oder bei nicht eingehaltenen Terminen. Schließlich haftet der Handwerksbetrieb voll für seine Subunternehmen! Ein weiterer kritischer Punkt ist die fachliche und vertragsrechtliche Verbindung zwischen VOB Teil B und Teil C. Die Bedeutung von VOB C wird oft unterschätzt, obwohl sie die vertragsgemäße Umsetzung technischerseits regelt. Beispielsweise bestimmt die DIN 18380 für Heizungsinstallationen unter anderem, welche Unterlagen der Installateur spätestens bei Abnahme vorlegen muss. Viele Unternehmen kennen die Auflistung der Unterlagen nicht und geben infolgedessen eine unvollständige Dokumentation ab, was zu Problemen bei der Abnahme führen kann.
Diese Schulungen bietet die Builtech Academy für die Builtech Unternehmen an:
- VOB – Grundlagenseminar
- VOB – Praxisgerechte Anwendung
- VOB – Vertiefung: firmenspezifische Praxisfälle
- VOB – Dokumentation und Mängelbeseitigung
Können Sie weitere typische Szenarien beschreiben, in denen Unwissenheit zu einem Nachteil für Handwerksbetriebe wird?
Gerne. Eines der gravierendsten Probleme sind Formfehler. Kommt es beispielsweise vor, dass Planungsfehler seitens des Auftraggebers später zu Mängeln an der Leistung des Unternehmers führen, regelt die VOB, dass der Auftragnehmer trotzdem haftbar gemacht wird. Der Weg, um dies zu vermeiden, liegt darin, vor Ausführung der Arbeiten die vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen genau zu prüfen und gegebenenfalls auf Fehler hinzuweisen, also seine Bedenken geltend zu machen. Das wird jedoch häufig versäumt oder nicht formgemäß vorgebracht. Ein weiteres häufiges Problem ist die unterlassene Behinderungsanzeige. So kann es beispielsweise passieren, dass ein Elektriker beim Verlegen von Kabeln feststellt, dass an der vorgesehenen Stelle keine Durchbrüche vorhanden sind. Wird in einem solchen Fall keine Behinderungsanzeige gemacht, werden ggf. seine Ausführungsfristen nicht verlängert und es können Vertragsstrafen für den Auftragnehmer für nicht rechtzeitig erbrachte Leistungen drohen. Auch im Fall von behaupteten Mängeln bei der Abnahme haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, den Gegenbeweis zu erbringen. Hier bietet die VOB jedoch Werkzeuge an, um dem vorzubeugen. So ist etwa eine Zustandsbesichtigung beziehungsweise technische Abnahme im Vorfeld möglich, bei der dokumentarisch festgehalten wird, dass die Leistung mängelfrei und abnahmereif ist. Gerade bei Leistungen, die bei der Abnahme nicht mehr sichtbar sind, wie etwa bei Fußbodenheizungen, sollte die Zustandsbesichtigung unbedingt in den Zeitplan integriert werden.
Wie können Betriebe sicherstellen, künftig weniger Fehler in Bezug auf die VOB zu machen?
Das A und O ist ein dauerhaftes Engagement und kontinuierliche Recherche. Es reicht nicht, sich einmal mit der VOB zu beschäftigen und sich darauf auszuruhen. Vielmehr sollte man sich auf Schwerpunkte fokussieren und regelmäßig analysieren, welche Neuerungen und Erkenntnisse für den eigenen Betrieb relevant sind. Viele der vorhandenen Nachschlagewerke sind zwar hilfreich, jedoch oft von Anwälten und nicht von Praktikern verfasst, was die Materie für Nichtjuristen manchmal recht unverständlich macht. Aus meiner Erfahrung hilft es zum einen, sich mit anderen Betrieben zu vernetzen und einen offenen Erfahrungsaustausch zu pflegen. Zum anderen sind Seminare ebenfalls eine exzellente Möglichkeit, individuell auf die Bedürfnisse einzelner Handwerksbetriebe einzugehen. In diesen Programmen – etwa auch in Kooperation mit der Builtech Academy – wird gemeinsam mit dem Handwerksbetrieb erarbeitet, wo die Probleme liegen und wie man diese gezielt angehen kann.
Frau Dr. Jost, vielen Dank für das Gespräch.
Teile diesen Artikel auf: